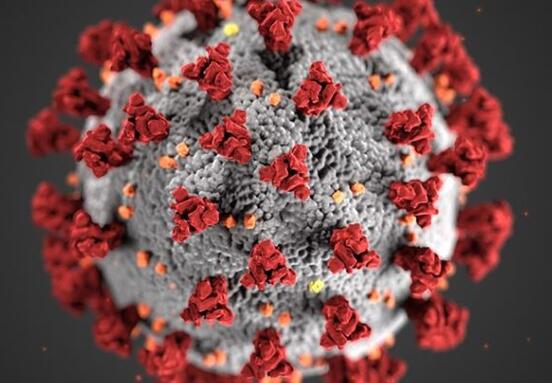Die Einladung zur Podiumsdiskussion klang vielversprechend, wenngleich auch ein bisschen seicht: „Wie sieht ihre Stadt von morgen aus?" Letztlich mussten aber die Zuhörer im Architekturzentrum in Wien in dieser Woche ziemlich deftige Kost verdauen. Schließlich wurde am Ende vor allem über die Frage diskutiert, inwieweit sich in einem Zeithorizont von 40, 50 Jahren ein sinnvoller architektonischer Kontext an der Schwelle zwischen privatem Rückzug und öffentlichem gemeinsamen Raum schaffen lässt.
Erste Projekte, die zeigen, wo die Reise hingehen kann, gibt es schon heute. Das Sonnwendviertel am Hauptbahnhof in Wien ist so ein Beispiel. Das städtebauliche Konzept sieht hier einen geschlossenen Rahmen entlang der Quartiersgrenzen und Offenheit im Inneren vor. In der Praxis heißt das: Der gesamte Freiraum im Inneren der Anlage wird als „Wohnraum" konzipiert; im 3. und 4. Geschoss gibt es eine sogenannte „Läufer-Ebene", die über Brücken die Gebäudeteile miteinander verbindet. An den „Läufern" sind auf 3000 Quadratmetern Allgemeinflächen angeschlossen - vom Wellnesscenter und Kino über Gemeinschaftsgärten bis hin zu einem Spielraum inklusive Kletterwand über drei Geschosse und Rutsche. Die Wohnungen selbst mussten dafür platzmäßig zurückstecken.
Freiräume schaffen
„Mit unserem Projekt wollen wir Freiräume schaffen und Freiheitsgrade ermöglichen", sagt Bernd Vlay, Architekt, Urbanist und Leiter des Büros Studio Vlay. „Es gibt viel, was man ausprobieren könnte. Aber am Ende kommt das Modell mit dem Wohnzimmer und dem Garten mit Zaun raus", sagt Vlay. „Worum geht es denn bei Grenzen? Es geht weniger um privat und öffentlich, sondern mehr um Vereinbarungen." Das sieht Peter Mörtenböck, Professor für visuelle Kultur an der TU Wien, ähnlich - und er nimmt vor allem die Architekten in die Pflicht. „Eine Form von Gemeinsamkeit ist uns völlig abhandengekommen - auch in der Architektur."
Auch Laura Spinadel, Leiterin von „BUS Architektur" und BOA ist überzeugt, dass die Architektur mehr dazu beitragen kann und muss, dass sich die Gesellschaft im öffentlichen Raum entfaltet. Wie es funktionieren kann, zeigt Spinadel beim WU Campus in Wien, für den sie als Masterplanerin zuständig war. Ob es funktioniert, wird sich laut Spinadel erst in einigen Jahren zeigen. Auf den ersten Blick scheint es jedenfalls gelungen zu sein, die „Forscher und Studenten von ihrem Turm der Wissenschaft in die banale, schmutzige Gesellschaft zu bringen", so Spinadel. „Wir müssen eine nachhaltige Balance zwischen sachlichen Technologien, sozialen Anregungen, kultureller Interaktion und individueller Wahrnehmung herstellen."
Mutiger werden
Wenn das richtig umgesetzt werde, brauche es keine Zäune für die Nutzer, ist Spinadel überzeugt. Den Anstoß dafür muss die Architektur geben - und die hat laut Spinadel den Anschluss verloren. „Wir müssen mutiger und unverschämter werden. Wenn sich die Menschen nicht bei mir wiederfinden, bin ich nutzlos geworden."
Quelle: wirtschaftsblatt.at